6.5 Imagines agentes als Erinnerungsanlässe
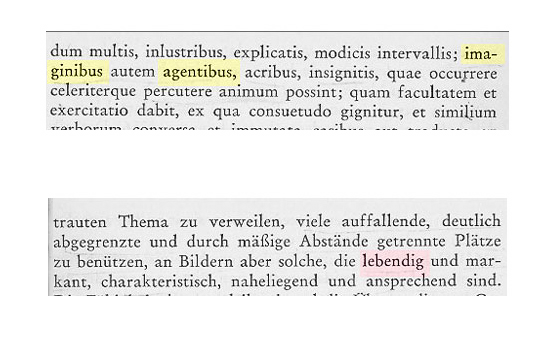

Das Haupt der Medusa.
Röm. Mosaik

6.5 Imagines agentes als Erinnerungsanlässe
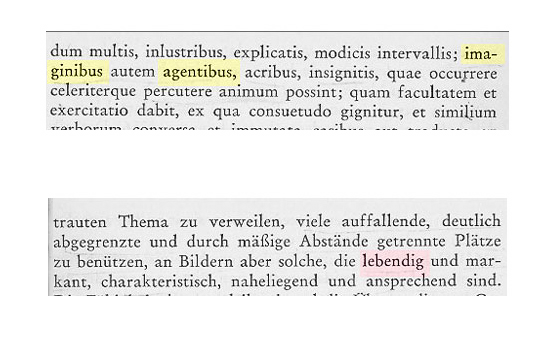

Das Haupt der Medusa.
Röm. Mosaik
6.5 Imagines agentes als Erinnerungsanlässe
Die auf den ersten Blick paradox erscheinende Koinzidenz von äußerer Starrheit und innerer Bewegung finden wir auch auf einem anderen Gebiet der römischen Kulturgeschichte: der Gedächtniskunst. Die ars memoria ist ein wichtiger Bestandteil der römischen Rhetorik. Denn ein guter Redner muss neben der Ideenfindung (inventio), der Gliederung (dispositio) und der Formulierung (elocutio) ein gutes Gedächtnis (memoria) haben, um schließlich im freien Vortrag (pronuntiatio/actio) zu überzeugen.
Das mnemotechnische Prinzip ist einfach, aber effektiv: Man sucht sich mentale Bilder (imagines) für die zu merkenden Sachverhalte und platziert sie an imaginären Orten (loci) – bevorzugt Gebäude mit vielen Portalen und Nischen, sogenannten "Gedächtnispalästen". Während des Vortrags werden dann im Geiste der Reihe nach die Gedächtnisorte abgeschritten.
Der Erfinder der Gedächtniskunst ist nach römischer Überlieferung der griechische Lyriker Simonides von Keos. Dieser habe gerade ein Festmahl verlassen, als der Palalst, in dem die Gäste sich aufhielten, über ihnen zusammenstürzte. Nach griechischem Brauch war es sehr wichtig, die Toten zu begraben. Doch die Identifikation von so grausam zerquetschten Leichen ist natürlich schwierig. Simonides aber habe problemlos Auskunft geben können, weil er sich erinnerte, wer wo gesessen hatte. So sei ihm die Erkenntnis gekommen, dass die Vorstellung von loci et imagines eine besonders gute Merkmethode sei. (#Ad Her. u. Cicero)
Der zentrale Abschnitt der memoria-Kapitel in den klassischen Handbüchern der Gedächtniskunst beschäftigt sich mit der Frage, welche Art von Bildern man sich am besten wählt. Die Antwort lautet, wie dem Cicero-Zitat zu entnehmen ist: imagines agentes. Damit sind Bilder gemeint, die so markant sind, dass sie gut im Gedächtnis bleiben – besonders schöne oder besonders hässliche Gesichter etwa – weil sie im Inneren des Meorierenden "etwas in Bewegung bringen" (Rhetorica Ad Herennium III, 22, 37).
Diese innere Dynamik korreliert aber mit äußerer Statik. Denn die imagines agentes können ihre Funktion nur erfüllen, wenn die Orte, von denen sie geistig abgerufen werden, in der Vorstellung klar und konstant sind. Ortsfestigkeit ist also eine zentrale Voraussetzung dafür, daß die Gedächtnisbilder ihre Lebendigkeit bewahren. Vor diesem Hintergrund wird verständlicher, warum Ovids Pygmalion just in der Erstarrung der Statue eine erste Lebensregung erkennt .
